
Elektroauto-Motoren: Die faszinierende Technik hinter der E-Mobilität
Inhalt
- Was für einen Motor hat ein Elektroauto?
- Welcher Motor ist in einem Elektroauto verbaut?
- Die Funktionsweise von Elektroautos im Detail
- Haben Elektroautos Gleichstrommotoren?
- Warum braucht ein Elektroauto kein Getriebe?
- Aktuelle Motortrends und Innovationen 2025
- Wartung und Lebensdauer von Elektromotoren
- Vergleich: Elektromotor vs. Verbrennungsmotor
- Fazit: Die Zukunft der Elektromobilität
Was für einen Motor hat ein Elektroauto?
Kraftvolle Eleganz trifft auf lautlose Effizienz – der Elektroauto-Motor revolutioniert unsere Vorstellung von Mobilität. Während Verbrenner mit hunderten beweglichen Teilen arbeiten, besteht das Herzstück eines E-Autos aus einem verblüffend simplen, aber hocheffizienten Elektromotor.
Im Gegensatz zu konventionellen Fahrzeugen nutzen Elektroautos keine Kolben, Ventile oder Nockenwellen. Stattdessen wandelt ein Elektromotor elektrische Energie direkt in mechanische Bewegung um. Diese fundamentale Unterscheidung macht Elektrofahrzeuge nicht nur umweltfreundlicher, sondern auch wartungsärmer und langlebiger. Der typische E-Auto-Motor besteht hauptsächlich aus zwei Komponenten: einem feststehenden Stator und einem rotierenden Rotor.
Die Funktionsweise von Elektroautos basiert auf dem Prinzip des elektromagnetischen Feldes. Wenn Strom durch die Wicklungen des Stators fließt, entsteht ein Magnetfeld, das den Rotor in Bewegung versetzt. Diese elegante Lösung ermöglicht es modernen Elektrofahrzeugen, Wirkungsgrade von 85 bis 95 Prozent zu erreichen – im Vergleich zu mageren 20 bis 35 Prozent bei Benzinmotoren und bis zu 45 Prozent bei modernen Dieselmotoren.
Besonders beeindruckend: Ein durchschnittlicher Elektromotor in einem Mittelklasse-Elektroauto wiegt nur etwa 50 bis 80 Kilogramm und liefert dabei eine Leistung von 150 bis 250 kW. Das entspricht 204 bis 340 PS bei einem Bruchteil des Gewichts eines vergleichbaren Verbrennungsmotors.
Welcher Motor ist in einem Elektroauto verbaut?
Die Vielfalt der Elektromotoren in modernen E-Fahrzeugen überrascht selbst Technikbegeisterte. Grundsätzlich dominieren drei Motortypen den Markt: Permanentmagnet-Synchronmotoren (PSM), Asynchronmotoren (ASM) und die neueste Innovation – Axialfluss-Motoren.
Der Permanentmagnet-Synchronmotor gilt als Goldstandard der E-Mobilität. Tesla Model 3, BMW iX3 und der Porsche Taycan setzen auf diese Technologie. PSM-Motoren nutzen starke Permanentmagnete aus Seltenen Erden im Rotor, wodurch sie besonders kompakt und effizient arbeiten. Mit Wirkungsgraden bis zu 97 Prozent und einem breiten Drehzahlband von 0 bis 20.000 U/min bieten sie optimale Performance.
Asynchronmotoren, auch Induktionsmotoren genannt, verzichten auf Permanentmagnete. Stattdessen induziert das Statorfeld Ströme im Rotor, die wiederum ein Magnetfeld erzeugen. Diese robuste Bauweise findet sich beispielsweise im Audi e-tron GT oder älteren Tesla Model S. Der Vorteil: keine Abhängigkeit von Seltenen Erden und geringere Herstellungskosten. Der Nachteil: etwas niedrigerer Wirkungsgrad bei etwa 90 bis 94 Prozent.
Die revolutionäre Axialfluss-Technologie, die 2025 verstärkt in Premium-Elektrofahrzeugen Einzug hält, verspricht eine neue Ära. Hersteller wie Mercedes-Benz mit ihrer YASA-Technologie oder Koenigsegg erreichen damit Leistungsdichten von über 10 kW/kg – das Dreifache konventioneller Radialfluss-Motoren.
Interessanterweise kombinieren viele Hersteller unterschiedliche Motortypen. Der Mercedes EQS nutzt beispielsweise einen PSM an der Hinterachse für maximale Effizienz und einen ASM an der Vorderachse für bedarfsgerechte Traktion. Diese intelligente Kombination ermöglicht Reichweiten von über 700 Kilometern.

Fun Fact
Der McLaren Artura nutzt einen Axialfluss-Motor, der bei nur 15,4 kg Gewicht satte 95 PS leistet. Das entspricht der Leistungsdichte eines Formel-1-Motors!
Die Funktionsweise von Elektroautos im Detail
Die Funktionsweise von Elektroautos offenbart sich als faszinierendes Zusammenspiel modernster Technologien. Im Zentrum steht die Energieumwandlung: Chemische Energie aus der Batterie wird in elektrische Energie transformiert, die wiederum vom Motor in mechanische Bewegung umgesetzt wird.
Der Prozess beginnt im Hochvolt-Batteriesystem, typischerweise mit 400 oder 800 Volt Spannung. Moderne Lithium-Ionen-Batterien speichern zwischen 50 und 120 kWh Energie – genug für 300 bis 800 Kilometer Reichweite. Die Batterie besteht aus hunderten einzelner Zellen, die in Modulen organisiert und vom Batteriemanagementsystem (BMS) überwacht werden.
Zwischen Batterie und Motor sitzt der Wechselrichter – das Gehirn des Antriebsstrangs. Diese hochkomplexe Leistungselektronik wandelt den Gleichstrom der Batterie in dreiphasigen Wechselstrom um. Dabei regelt sie präzise Frequenz und Spannung, um Drehmoment und Drehzahl des Motors zu steuern. Moderne Siliziumkarbid-Wechselrichter erreichen Schaltfrequenzen von über 50 kHz und Wirkungsgrade von 98 Prozent.
Der eigentliche Elektroauto-Motor arbeitet nach dem Drehfeldprinzip: Drei um 120 Grad versetzte Wicklungen im Stator erzeugen ein rotierendes Magnetfeld. Dieses Feld zieht den magnetischen Rotor mit und versetzt ihn in Drehung. Die Drehzahl lässt sich stufenlos von 0 bis zur Maximaldrehzahl regeln – ein entscheidender Vorteil gegenüber Verbrennern.
Wichtig:
Die Rekuperation, also die Energierückgewinnung beim Bremsen, funktioniert genau umgekehrt. Der Motor wird zum Generator, wandelt Bewegungsenergie in Strom um und speist diesen zurück in die Batterie. Moderne Systeme rekuperieren bis zu 300 kW Leistung.
Die Kühlung spielt eine zentrale Rolle: Hochleistungsmotoren nutzen ausgeklügelte Flüssigkeitskühlsysteme mit Kühlmänteln direkt in den Wicklungen. Teslas „Hairpin“-Wicklungstechnologie oder BMWs lasergeschweißte Kupferrotoren ermöglichen noch effizientere Wärmeableitung.
Ein spannender Aspekt der E-Motor-Technologie ist die Momentanleistung: Während Verbrenner erst Drehzahl aufbauen müssen, liefern Elektromotoren ihr maximales Drehmoment ab der ersten Umdrehung. Ein Tesla Model S Plaid entwickelt 1.420 Nm Drehmoment – sofort verfügbar für atemberaubende Beschleunigung in 2,1 Sekunden auf 100 km/h.
Haben Elektroautos Gleichstrommotoren?
Die Frage nach Gleichstrommotoren in modernen Elektroautos führt uns zurück zu den Anfängen der E-Mobilität. Tatsächlich nutzten frühe Elektrofahrzeuge wie der Detroit Electric von 1907 oder der erste Nissan Leaf noch bürstenbehaftete Gleichstrommotoren. Doch warum findet man diese Technologie in aktuellen Modellen kaum noch?
Gleichstrommotoren besitzen einen fundamentalen Nachteil: die Kohlebürsten. Diese mechanischen Kontakte übertragen den Strom auf den rotierenden Kollektor und unterliegen dabei einem ständigen Verschleiß. Nach etwa 50.000 bis 100.000 Kilometern müssen sie ersetzt werden – ein Wartungsaufwand, der dem Grundprinzip moderner E-Mobilität widerspricht.
Stattdessen dominieren heute bürstenlose Motoren den Markt. Diese arbeiten zwar intern mit Wechselstrom, werden aber oft als „BLDC" (Brushless DC) bezeichnet, da sie über eine elektronische Kommutierung verfügen. Der Trick: Die Leistungselektronik übernimmt die Aufgabe der mechanischen Bürsten und schaltet die Wicklungen elektronisch um.
Technischer Exkurs:
Moderne Permanentmagnet-Synchronmotoren nutzen sinusförmige Ansteuerung (PMSM), während echte BLDC-Motoren mit blockförmigen Strömen arbeiten. Der Unterschied zeigt sich in der Laufruhe: PMSM laufen vibrationsärmer und effizienter.
Es gibt jedoch Ausnahmen: Kleinere Hilfsantriebe wie Scheibenwischer, Lüfter oder Sitzverstellungen nutzen weiterhin kleine Gleichstrommotoren. Auch in der Formel E experimentieren Teams mit geschalteten Reluktanz-Gleichstrommotoren für spezielle Anwendungen.
Die Zukunft gehört eindeutig den bürstenlosen Systemen. Neue Entwicklungen wie die Transversalfluss-Technologie oder supraleitende Motoren versprechen noch höhere Leistungsdichten. Forscher am Fraunhofer-Institut erreichten 2024 mit einem supraleitenden Motor eine Leistungsdichte von 20 kW/kg – das Zehnfache konventioneller Motoren.

Warum braucht ein Elektroauto kein Getriebe?
Die Abwesenheit eines mehrstufigen Getriebes gehört zu den elegantesten Eigenschaften moderner Elektrofahrzeuge. Aber warum können E-Autos auf diese komplexe Mechanik verzichten, während Verbrenner ohne Getriebe undenkbar wären?
Die Antwort liegt in der Drehmomentkurve: Elektromotoren liefern ihr maximales Drehmoment bereits ab Stillstand und behalten eine hohe Leistung über einen enormen Drehzahlbereich bei. Ein typischer E-Motor arbeitet effizient zwischen 0 und 20.000 U/min – ein Bereich, für den ein Verbrenner mindestens 6 bis 8 Gänge benötigen würde.
Verbrennungsmotoren hingegen erreichen ihr optimales Drehmoment erst in einem schmalen Drehzahlband, typischerweise zwischen 2.000 und 4.000 U/min. Darunter fehlt die Kraft, darüber sinkt die Effizienz dramatisch. Das Getriebe überbrückt diese Schwäche durch Übersetzungsänderungen.
Die meisten Elektroautos nutzen eine feste Übersetzung zwischen Motor und Rädern, oft im Verhältnis 8:1 bis 10:1. Diese Untersetzung ermöglicht hohe Radmomente für kraftvolle Beschleunigung bei gleichzeitig hohen Endgeschwindigkeiten. Der Mercedes EQS erreicht mit einer einzigen Übersetzung sowohl sanftes Anfahren als auch 210 km/h Spitze.
Wichtig:
Das Fehlen eines Schaltgetriebes bedeutet nicht nur weniger Gewicht und Komplexität, sondern auch höhere Effizienz. Jede Getriebestufe kostet etwa 2 bis 3 Prozent Wirkungsgrad durch Reibungsverluste.
Es gibt allerdings Ausnahmen: Der Porsche Taycan nutzt ein innovatives Zweigang-Getriebe an der Hinterachse. Der erste Gang ermöglicht explosive Beschleunigung, der zweite Gang optimiert Effizienz und Höchstgeschwindigkeit. Porsche erreicht damit den Sprint auf 100 km/h in 2,8 Sekunden bei gleichzeitig über 260 km/h Spitze.
Auch Nutzfahrzeuge experimentieren mit Mehrganggetrieben. Der Mercedes eActros nutzt eine 2-Gang-Achse für optimale Zugkraft beim Anfahren mit 40 Tonnen Gesamtgewicht. ZF entwickelte sogar ein 2-Gang-Getriebe speziell für E-Achsen, das ab 2025 in Serie geht.
Zukunftstrend: Radnabenmotoren eliminieren jegliche Übersetzung. Jedes Rad erhält seinen eigenen Motor – maximale Effizienz bei perfekter Traktion. Prototypen von Protean Electric oder Elaphe zeigen beeindruckende Ergebnisse.
Die Einfachheit des E-Antriebs zeigt sich auch in Zahlen: Ein moderner Elektromotor besteht aus etwa 20 beweglichen Teilen, ein Verbrennungsmotor mit Getriebe aus über 2.000. Weniger Teile bedeuten weniger Verschleiß, weniger Wartung und höhere Zuverlässigkeit.
Aktuelle Motortrends und Innovationen 2025
Das Jahr 2025 markiert einen Wendepunkt in der Elektromotoren-Entwicklung. Neue Technologien und Materialien revolutionieren, was unter der Haube moderner E-Fahrzeuge möglich ist. Die Innovationen reichen von neuen Motorkonzepten bis zu bahnbrechenden Fertigungsmethoden.
Die Hairpin-Wicklungstechnologie setzt neue Maßstäbe in der Leistungsdichte. Statt runder Drähte nutzen Hersteller rechteckige Kupferleiter, die wie Haarnadeln geformt und präzise gestapelt werden. Der Füllfaktor der Wicklung steigt von 45 auf über 70 Prozent. Lucid Motors erreicht mit dieser Technik 670 PS aus einem nur 34 kg schweren Motor.
Siliziumkarbid-Halbleiter (SiC) revolutionieren die Leistungselektronik. Diese neuen Chips schalten schneller, vertragen höhere Temperaturen und reduzieren Verluste um bis zu 50 Prozent. Tesla integriert SiC-Inverter im Model 3, was die Reichweite um 10 Prozent erhöht. Der Preis für SiC-Chips fiel 2024 unter die kritische Marke von 1 Dollar pro Ampere – Massenmarkt-Tauglichkeit erreicht.
Ein weiterer Trend sind Axialfluss-Motoren. Anders als bei herkömmlichen Radialfluss-Designs fließt das Magnetfeld parallel zur Drehachse. Das Ergebnis: pancake-flache Motoren mit extremer Leistungsdichte. YASA, jetzt Teil von Mercedes-Benz, produziert Axialfluss-Motoren für den AMG.EA Performance Hybrid mit 150 kW bei nur 24 kg Gewicht.
800-Volt-Architekturen werden zum neuen Standard. Nach Pionieren wie Porsche und Hyundai ziehen 2025 auch Volumenhersteller nach. Höhere Spannung bedeutet geringere Ströme bei gleicher Leistung – dünnere Kabel, weniger Gewicht, schnelleres Laden. Der Hyundai Ioniq 6 lädt mit 350 kW in 18 Minuten von 10 auf 80 Prozent.
Die magnetfreie Motortechnologie gewinnt an Bedeutung. Synchron-Reluktanzmotoren verzichten auf Seltene Erden und nutzen stattdessen gezielt gestaltete Luftspalte im Rotor. BMW entwickelt für die „Neue Klasse“ stromerregt Synchronmotoren ohne Permanentmagnete – nachhaltig und kostengünstiger.
Integrierte E-Achsen kombinieren Motor, Inverter und Getriebe in einer kompakten Einheit. Bosch, ZF und Continental liefern sich ein Wettrennen um die höchste Integration. Die neueste Generation erreicht Leistungsdichten über 6 kW/kg bei Systemwirkungsgraden über 95 Prozent.
Ein revolutionärer Ansatz sind In-Wheel-Motoren der zweiten Generation. Protean Electric und Elaphe überwinden die Herausforderungen der ungefederten Masse durch ultraleichte Konstruktionen. Der Lightyear 0 nutzt In-Wheel-Motoren für maximale Effizienz und erreicht damit über 600 km Reichweite.
Die Fertigungstechnologie macht ebenfalls Sprünge: Laser-Kupferschweißen ermöglicht perfekte Verbindungen in Hairpin-Wicklungen. 3D-gedruckte Kühlkanäle direkt in den Wicklungen steigern die Dauerleistung um 30 Prozent. KI-optimierte Wicklungsmuster reduzieren Wirbelstromverluste auf ein Minimum.
Wartung und Lebensdauer von Elektromotoren
Die Wartungsarmut von Elektromotoren gehört zu den unterschätzten Vorteilen der E-Mobilität. Während Verbrennungsmotoren regelmäßige Ölwechsel, Zündkerzen-Tausch und Zahnriemen-Erneuerung benötigen, laufen E-Motoren nahezu wartungsfrei über ihre gesamte Lebensdauer.
Die Lebensdauer moderner Elektromotoren übertrifft oft die des Fahrzeugs selbst. Hersteller kalkulieren mit mindestens 500.000 Kilometern – viele Motoren halten deutlich länger. Tesla-Fahrer berichten von über 800.000 Kilometern ohne nennenswerten Leistungsverlust. Der Grund: Nur ein bewegliches Teil (der Rotor) und keine mechanische Reibung durch berührungslose Magnetlagerung.
Wartungsintervalle beschränken sich auf wenige Punkte: Alle 2 bis 3 Jahre empfiehlt sich ein Wechsel der Kühlflüssigkeit. Die Isolierung der Wicklungen sollte alle 100.000 Kilometer geprüft werden – meist per Software-Diagnose ohne Demontage.
Die größte Herausforderung stellt die thermische Belastung dar. Dauerhaft hohe Temperaturen können die Wicklungsisolation altern lassen. Moderne Thermomanagement-Systeme halten die Temperatur jedoch konstant unter 150 °C. Premium-Hersteller wie Porsche kühlen sogar den Rotor von innen – perfekt für Rennstrecken-Einsätze.
Wichtig:
Regelmäßige Software-Updates optimieren die Motorsteuerung und können sogar die Leistung steigern. Tesla erhöhte per Over-the-Air-Update die Leistung des Model 3 Performance um 5 Prozent.
Ein wichtiger Aspekt ist die Regenerationsfähigkeit: Kleinere Schäden an Wicklungen lassen sich durch gezieltes „Einbrennen“ selbst reparieren. Die Steuerungssoftware erkennt fehlerhafte Bereiche und kompensiert durch angepasste Ansteuerung.
Die Diagnose erfolgt vollautomatisch: Moderne E-Autos überwachen kontinuierlich Temperatur, Vibration und elektrische Parameter. Anomalien werden erkannt, bevor sie zu Ausfällen führen. Predictive Maintenance wird Realität – das Auto meldet Wartungsbedarf, bevor Probleme auftreten.
Praktische Tipps für lange Lebensdauer:
- Hohe Leistungsabrufe bei kaltem Motor vermeiden
- Die Vorkonditionierung im Winter nutzen
- Bevorzugt mit moderater Leistung (AC statt DC) laden
- Nutzung von ECO-Modi für geringere thermische Belastung
Die Reparatur von E-Motoren erfordert Spezialwissen, ist aber möglich. Wicklungen lassen sich erneuern, Lager tauschen, Magnete ersetzen. Die Kosten liegen typischerweise bei 3.000-5.000 Euro – deutlich günstiger als ein Motortausch beim Verbrenner.
Vergleich: Elektromotor vs. Verbrennungsmotor
Der direkte Vergleich zwischen Elektro- und Verbrennungsmotor offenbart fundamentale Unterschiede, die weit über die reine Antriebsart hinausgehen. Beide Technologien repräsentieren unterschiedliche Epochen der Ingenieurskunst.
Wirkungsgrad markiert den dramatischsten Unterschied: Moderne Elektromotoren wandeln 85 bis 95 Prozent der zugeführten Energie in Bewegung um, wobei Permanentmagnet-Synchronmotoren bis zu 97 Prozent erreichen können. Verbrennungsmotoren erreichen selbst unter Idealbedingungen nur 20 bis 35 Prozent (Benzin) bzw. bis zu 45 Prozent (Diesel) – der Rest verpufft als Wärme. Ein Tesla Model 3 nutzt aus 75 kWh Batteriekapazität etwa 71 kWh für Vortrieb. Ein vergleichbarer BMW 3er verbrennt für dieselbe Strecke Benzin mit einem Energiegehalt von 210 kWh.
Die Leistungsentfaltung unterscheidet sich fundamental: E-Motoren liefern maximales Drehmoment ab 0 U/min – sofortige, lineare Beschleunigung ohne Zugkraftunterbrechung. Verbrenner müssen erst Drehzahl aufbauen, Gänge wechseln, Turbolöcher überwinden. Der Porsche Taycan Turbo S mobilisiert 1.050 Nm Drehmoment instantan – ein Verbrenner bräuchte 12 Zylinder und Turboaufladung für ähnliche Werte.
Beim Bauraum glänzen E-Motoren: Ein 350 kW starker Elektromotor misst etwa 40 × 30 cm und wiegt 80 kg. Ein gleich starker V8-Motor benötigt das Dreifache an Platz und wiegt über 200 kg – ohne Getriebe, Abgasanlage und Nebenaggregate.
Die Komplexität trennt Welten: Ein E-Motor besteht aus etwa 20 beweglichen Teilen, ein moderner Turbobenziner aus über 1.000. Weniger Teile bedeuten weniger Verschleiß, geringere Ausfallwahrscheinlichkeit, niedrigere Wartungskosten. Eine Studie des ADAC beziffert die Wartungskosten von E-Autos auf 35 Prozent eines vergleichbaren Verbrenners.
Umweltaspekte sprechen klar für E-Motoren: Null lokale Emissionen, kein Feinstaub durch Verbrennung, deutlich geringere Lärmemissionen. Selbst mit deutschem Strommix (2024: 60 % erneuerbar) emittiert ein E-Auto nur 50 % des CO₂ eines effizienten Diesels.
Schwächen des E-Motors: Die Energiedichte der Batterien limitiert die Reichweite. Schnellladen stresst die Batterie. Seltene Erden in Permanentmagneten werfen Nachhaltigkeitsfragen auf. Die Infrastruktur hinkt dem Bedarf hinterher.
Stärken des Verbrenners: Hohe Energiedichte des Kraftstoffs ermöglicht 1.000+ km Reichweite. Betanken in 3 Minuten. Ausgereifte Infrastruktur weltweit. Emotionaler Sound für Enthusiasten. Unabhängigkeit vom Stromnetz.
Die Zukunft deutet auf Koexistenz: E-Motoren dominieren Stadt und Kurzstrecke, Verbrenner bleiben für Langstrecke und spezielle Anwendungen relevant. Synthetische Kraftstoffe könnten Verbrenner CO₂-neutral machen. Die beste Technologie hängt vom Einsatzzweck ab.
Fazit: Die Zukunft der Elektromobilität
Kraftvolle Eleganz trifft auf nachhaltige Effizienz – die Reise durch die Welt der Elektromotoren führt uns zurück zur philosophischen Ausgangsfrage: Was macht den perfekten Antrieb aus? Die Antwort 2025 lautet: Es kommt darauf an.
Der Elektroauto-Motor hat sich als überlegene Technologie für den Großteil unserer Mobilitätsbedürfnisse etabliert. Mit Wirkungsgraden nahe der physikalischen Grenze, minimaler Wartung und beeindruckender Leistungsentfaltung definieren moderne E-Motoren neu, was technisch möglich ist. Die Funktionsweise von Elektroautos – einst belächelt als Spielerei – übertrifft heute in fast allen Parametern den Verbrenner.
Von bürstenlosen Synchronmotoren über innovative Axialfluss-Designs bis zu integrierten E-Achsen: Die Vielfalt der Lösungen zeigt die Dynamik dieser Technologie. Dass Elektroautos kein Getriebe brauchen, vereinfacht nicht nur die Konstruktion, sondern verbessert auch Zuverlässigkeit und Effizienz.
Die Zukunft verspricht weitere Quantensprünge: Festkörperbatterien werden die Reichweitenangst eliminieren. Induktives Laden macht Kabel überflüssig. Autonomes Fahren und E-Mobilität verschmelzen zur ultimativen Transportlösung.
Doch bei aller Technologie-Begeisterung: Der beste Motor ist der, der zu den individuellen Bedürfnissen passt. Für Pendler, Stadtbewohner und Umweltbewusste führt kein Weg am E-Antrieb vorbei. Für Vielfahrer, Anhänger-Nutzer oder Motorsport-Enthusiasten mögen Alternativen (noch) sinnvoller sein.
FAQ
Aktuelle Angebote zu Jetzt Elektroautos auf AutoScout24.de finden

Kia EV3EV3 81.4 KWH EARTH MJ26 WINTER BUSINESS UPGRADE DR
€ 39.4901- 11/2025
- 15 km
- Elektro
- - (kWh/100 km)
Neu
Kia EV3EV3 81.4 KWH GT-LINE MJ26 DRIVEWISE-PARK-PRO KOMFO
€ 43.4901- 11/2025
- 15 km
- Elektro
- - (kWh/100 km)
Neu
Opel Vivaro Kasten -e (75kWh) (L2) Edition M 2xKlima
€ 35.9971- 03/2024
- 100 km
- Elektro
- - (kWh/100 km)
Neu
Volkswagen ID.5Pro Performance
€ 28.460- 06/2022
- 28.820 km
- Elektro
- - (kWh/100 km)
Neu
Volkswagen ID.5GTX 4Motion
€ 42.900- 08/2024
- 12.989 km
- Elektro
- - (kWh/100 km)
Neu
Renault ZOEZOE (mit Batterie) Z.E. 50 EXPERIENCE - CCS
€ 13.9901- 06/2021
- 51.862 km
- Elektro
- - (kWh/100 km)
NeuPorsche Macan
€ 96.6941- -
- 0 km
- Elektro
- - (kWh/100 km)
Neu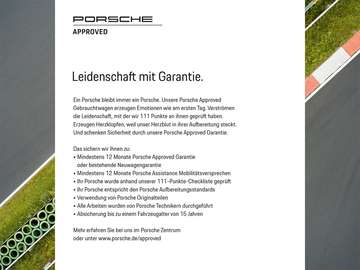
Porsche TaycanGTS
€ 92.9001- 10/2023
- 11.565 km
- Elektro
- - (kWh/100 km)
Neu
Fiat 500eIcon+42kWh+WINTER+PARK+KOMFORT+NAVI+KLIMAAUTO+ALU+
€ 19.9901- 11/2022
- 49 km
- Elektro
- - (kWh/100 km)
Neu
Volkswagen ID.3Pure Performance*Navi LED VKZ-Erken PDCv+h
€ 16.7791- 08/2021
- 63.320 km
- Elektro
- - (kWh/100 km)
Neu


