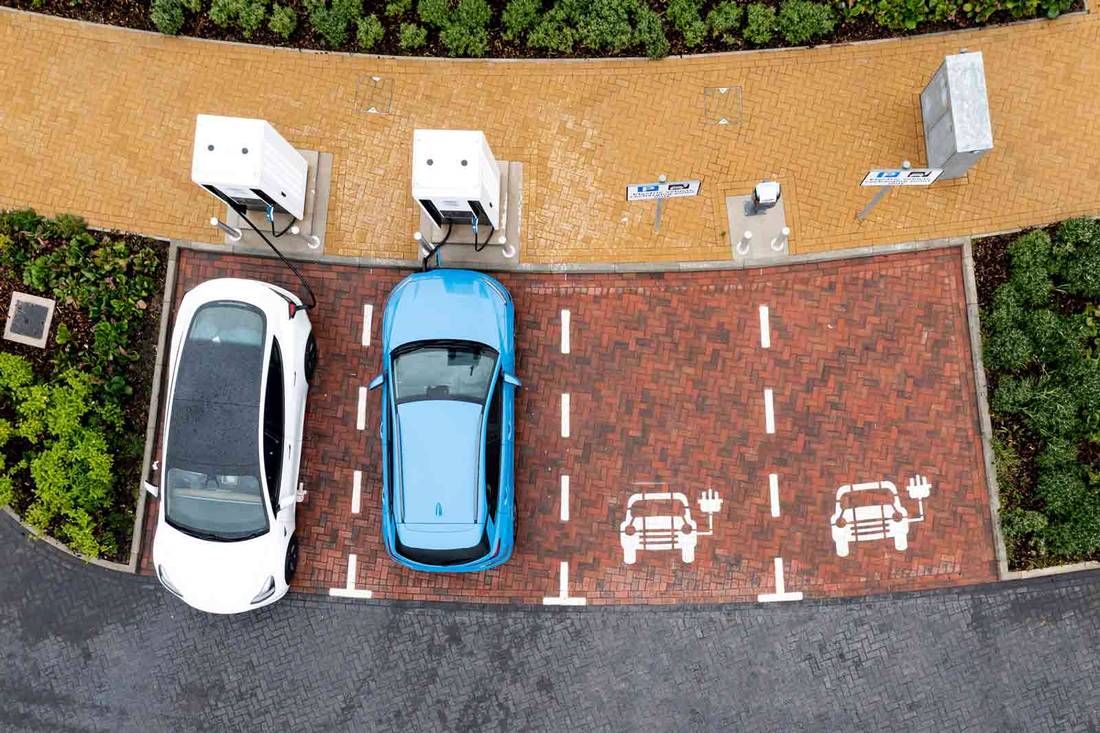Leistungselektronik und Steuergeräte
Die Leistungselektronik bildet das Nervensystem des Aufbaus eines reinen Elektroautos – unsichtbar, aber unverzichtbar für die Transformation von gespeicherter zu nutzbarer Energie. Hier verschmelzen Halbleitertechnologie und Software zu einem hochkomplexen Gesamtsystem.
Das Herzstück ist der Inverter (Wechselrichter), der die Gleichspannung der Batterie in dreiphasigen Wechselstrom für den Motor wandelt. Moderne Inverter arbeiten mit Siliziumkarbid (SiC) MOSFETs, die gegenüber klassischen Silizium-IGBTs mehrere Vorteile bieten:
- Höhere Schaltfrequenzen (20 bis 50 kHz)
- Geringere Verluste (bis zu 70 % Reduktion)
- Kompaktere Bauweise
- Bessere Temperaturbeständigkeit
Die Ansteuerung erfolgt über Pulsweitenmodulation (PWM), bei der die Ausgangsspannung durch schnelles Ein- und Ausschalten moduliert wird. Die Präzision ist beeindruckend: Schaltzeiten unter 50 Nanosekunden ermöglichen saubere Sinuskurven und minimale Oberwellen.
On-Board-Charger (OBC) wandeln Wechselstrom aus dem Stromnetz in Gleichstrom für die Batterie. Aktuelle Systeme erreichen:
- 11 bis 22 kW Ladeleistung (dreiphasig)
- Bidirektionale Fähigkeiten (V2G/V2H)
- Wirkungsgrade über 95 %
- Powerfaktor nahe 1,0
Der DC/DC-Wandler versorgt das 12V-Bordnetz mit bis zu 3 kW Leistung. Moderne Designs nutzen resonante Topologien für höchste Effizienz und galvanische Trennung für Sicherheit. Die Ausgangsspannung wird präzise auf 14,2V geregelt, um die 12V-Batterie optimal zu laden.
Das Steuergeräte-Netzwerk koordiniert alle Funktionen:
Vehicle Control Unit (VCU): Das Hauptsteuergerät interpretiert Fahrerwünsche, koordiniert Antrieb und Rekuperation, überwacht Sicherheitsfunktionen.
Battery Management System (BMS): Überwacht jeden Aspekt der Batterie, von Zellspannungen über Temperaturen bis zum Isolationswiderstand.
Thermal Management Control Unit: Steuert Pumpen, Ventile und Kompressoren für optimale Temperierung aller Komponenten.
Motor Control Unit (MCU): Regelt präzise Drehmoment und Drehzahl des Motors, überwacht Rotorposition und Wicklungstemperaturen.
Die Software-Komplexität ist enorm: Über 100 Millionen Zeilen Code steuern ein modernes E-Auto. Over-the-Air Updates ermöglichen kontinuierliche Verbesserungen - Tesla hat so die Beschleunigung des Model 3 nachträglich um 5 % gesteigert.
Zukunftstrends in der Leistungselektronik:
- GaN (Galliumnitrid) ermöglicht noch höhere Schaltfrequenzen
- 800V-Systeme werden zum Standard für Schnellladen
- Integration von Inverter, OBC und DC/DC in einer Unit
- KI-basierte prädiktive Regelung optimiert Effizienz