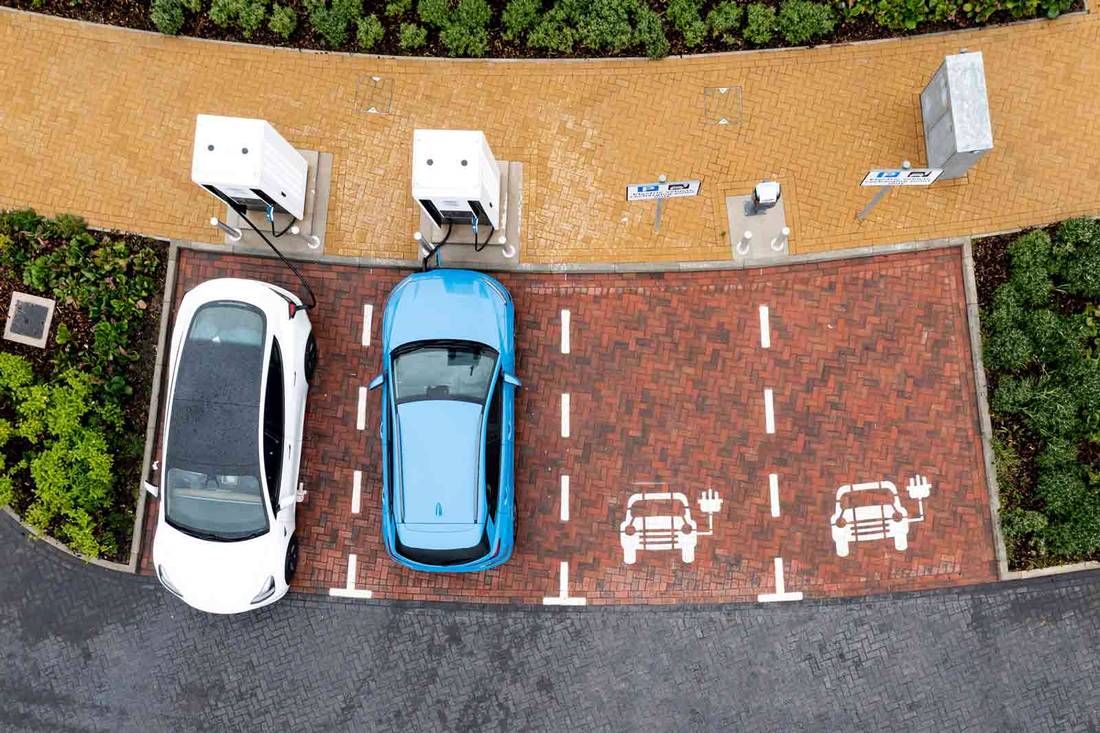Die Physik dahinter: So arbeiten elektrische Wärmepumpen im Fahrzeug
Die Frage "Werden Wärmepumpen elektrisch betrieben?" mag trivial erscheinen, doch dahinter verbirgt sich faszinierende Thermodynamik. Ja, Wärmepumpen benötigen elektrische Energie – aber sie multiplizieren diese auf geradezu magische Weise.
Das Herzstück jeder automotiven Wärmepumpe ist der elektrisch angetriebene Kompressor. Mit einer Leistungsaufnahme von typischerweise ein bis 1,5 kW treibt er den thermodynamischen Kreislauf an. Das Besondere: Dieser Kompressor bewegt nicht nur Wärme, er erschafft sie durch Druckerhöhung. Wenn das gasförmige Kältemittel komprimiert wird, steigt seine Temperatur auf bis zu 80 Grad Celsius – perfekt für die Fahrzeugheizung.
Der Carnot-Wirkungsgrad definiert die theoretische Obergrenze: Bei einer Außentemperatur von 0°C und einer gewünschten Innentemperatur von 20°C kann eine ideale Wärmepumpe einen COP (Coefficient of Performance) von 10,7 erreichen. In der Praxis limitieren Reibungsverluste, nicht-ideale Kältemittel und Wärmeübertragungswiderstände diesen Wert. Moderne Fahrzeug-Wärmepumpen erreichen dennoch beeindruckende COP-Werte von drei bis vier – dreimal so effizient wie jede Widerstandsheizung.
Die neueste Generation nutzt CO2 (R744) als natürliches Kältemittel. Mit einem GWP (Global Warming Potential) von eins ist es 1.430-mal klimafreundlicher als das früher verwendete R134a. Zudem ermöglicht CO2 durch seinen besonderen thermodynamischen Kreislauf höhere Vorlauftemperaturen – ideal für schnelles Aufheizen bei extremer Kälte.
Intelligente Steuerungssysteme optimieren den Betrieb kontinuierlich. Sensoren messen Außentemperatur, Innenraumtemperatur, Luftfeuchtigkeit, Sonneneinstrahlung und sogar die Anzahl der Insassen. Algorithmen berechnen daraus den optimalen Betriebspunkt. Besonders clever: Moderne Systeme nutzen die Abwärme der Leistungselektronik und des Elektromotors als zusätzliche Wärmequelle. Bei sportlicher Fahrweise kann dies bis zu 2 kW zusätzliche Heizleistung bedeuten.